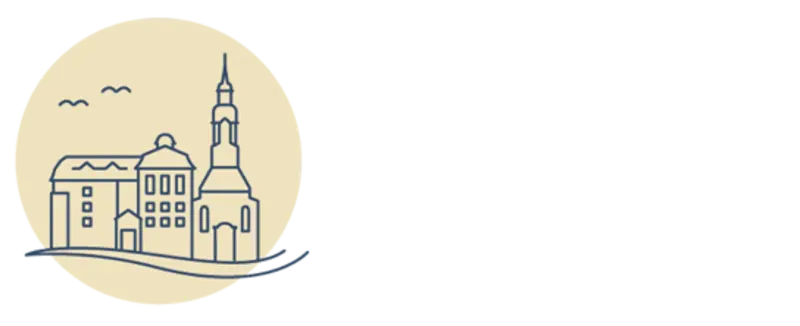Hinweisflut im Netz – Warum Datenschutzhinweise 2025 allgegenwärtig sind | Taucha kompakt
Hinweisflut im Netz – Warum Datenschutzhinweise 2025 allgegenwärtig sind
Im Sommer 2025 fällt vielen Menschen auf, dass sie beim Surfen im Internet häufiger als je zuvor auf Hinweise zu Datenschutz und Datennutzung stoßen. Ob auf Nachrichtenseiten, in Shopping-Apps oder bei Streamingdiensten – Pop-ups, Banner und zusätzliche Infokästen begleiten nahezu jeden Klick.
Diese Entwicklung hat klare Ursachen: Neue europäische Rechtsvorgaben wie der Digital Services Act und der Data Act verpflichten Anbieter, transparenter mit Nutzerdaten umzugehen. Die Folge ist eine deutlich sichtbare Zunahme an Hinweisen, die nicht nur über Cookies, sondern auch über Werbezwecke, Datenzugriffsrechte und Plattformwechseloptionen informieren. Für Verbraucher ist es wichtig zu verstehen, warum diese Hinweise erscheinen, was sie bedeuten und wie man zwischen relevanten und eher werblichen Meldungen unterscheiden kann.
Neue Regeln bringen mehr sichtbare Hinweise
Der Digital Services Act ist seit 2024 vollständig in Kraft und verändert den Umgang mit Nutzern und Inhalten im Netz nachhaltig. Ziel der Verordnung ist es, das digitale Umfeld sicherer zu gestalten und mehr Transparenz zu schaffen. Dazu gehören klare Vorgaben zur Kennzeichnung von Werbung, Offenlegung von Empfehlungsalgorithmen und die Pflicht, Inhalte und Moderationsentscheidungen nachvollziehbar zu machen. Besonders umfangreiche Pflichten treffen Very Large Online Platforms, die monatlich mindestens 45 Millionen Nutzer in der EU erreichen.
Seit 2025 gilt die Pflicht zur Veröffentlichung jährlicher Transparenzberichte für alle großen Online-Dienste, die nicht als Kleinst- oder Kleinunternehmen im Sinne des DSA eingestuft sind. Für Very Large Online Platforms und Very Large Online Search Engines bestehen darüber hinaus zusätzliche und häufigere Berichtspflichten.
Der Data Act ergänzt diesen Rahmen mit einem anderen Schwerpunkt: Er trat im Januar 2024 in Kraft und ist seit dem 12. September 2025 vollständig anwendbar. Er regelt den Zugang zu und die Weitergabe von Daten, insbesondere bei vernetzten Geräten und Diensten. Verbraucher erhalten ein ausdrückliches Recht auf Zugriff auf ihre selbst erzeugten Daten sowie auf dazugehörige Metadaten.
Zudem verpflichtet der Data Act Anbieter dazu, Wechselprozesse zwischen Plattformen zu ermöglichen und klar zu erklären. Das bedeutet in der Praxis, dass Nutzer bei der Einrichtung eines Smart-Home-Geräts oder einer IoT-App Hinweise sehen können, die detailliert über Datenzugriff, Exportmöglichkeiten und Drittzugriffe informieren. Diese Einblendungen sind gesetzlich vorgeschrieben und nicht einfach nur freiwillige Zusatzinformationen.
Alltagserfahrungen mit der Hinweisflut
Die neuen Regelungen wirken sich direkt auf das Nutzererlebnis aus. Wer heute eine Plattform besucht, trifft nicht nur auf klassische Cookie-Hinweise, sondern auf eine Vielzahl zusätzlicher Informationsfenster. Diese können etwa über personalisierte Werbung aufklären, die Funktionsweise von Empfehlungsalgorithmen erläutern oder angeben, welche Daten für einen Dienst erhoben und wie sie genutzt werden. Bei Diensten mit vernetzten Geräten kommen Einblendungen hinzu, die über Datenverfügbarkeit und Wechseloptionen informieren.
Auch im Bereich des Online-Glücksspiels in Deutschland gibt es seit Einführung der zentralen Lizenzierung durch die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder verpflichtende Registrierungs- und Identitätsprüfungen. Wer sich bei einem GGL-lizenzierten Online-Casino anmeldet, anstatt bei einem Anbieter, bei dem man kein Konto eröffnen muss, erhält daher ebenfalls Datenschutzhinweise. Im Rahmen der Anmeldung sind die Anbieter verpflichtet, über Datenschutz und Datenverarbeitung zu informieren; die Nutzer müssen diese Hinweise aktiv zur Kenntnis nehmen und bestätigen, bevor sie den Dienst nutzen können.
Für Verbraucher entsteht dadurch eine neue Herausforderung: Sie müssen einschätzen können, welche Hinweise wirklich wichtig sind und auf welche man nicht zwingend reagieren muss. Pflichtinformationen betreffen meist Aspekte wie Cookie- und Trackingbanner nach DSGVO, Erklärungen zu Profiling und Werbung gemäß DSA oder Hinweise zu Datenexportrechten nach Data Act. Dagegen nutzen Unternehmen auch freiwillige Hinweise, um Zusatzdienste zu bewerben oder auf eine optimierte Nutzererfahrung hinzuweisen – ohne dass dafür eine rechtliche Verpflichtung besteht.
Mehr Rechte und mehr Verantwortung für Verbraucher
Die Datenschutz-Grundverordnung bleibt weiterhin das Fundament der europäischen Datenschutzgesetzgebung und sichert Rechte wie Auskunft, Löschung oder Widerspruch gegen nicht notwendige Datenverarbeitungen. Neu ist jedoch, dass der DSA und der Data Act diese Rechte in bestimmten Kontexten konkretisieren und erweitern. Nutzer haben nicht nur Anspruch auf transparente Informationen, sondern oft auch auf direkte Einflussmöglichkeiten, etwa durch einfachere Opt-out-Optionen oder standardisierte Datenexportfunktionen. Gleichzeitig liegt es in der Verantwortung der Verbraucher, diese neuen Möglichkeiten zu kennen und zu nutzen.
Wer die Hintergründe versteht, kann die wachsende Anzahl an Hinweisen nicht nur als lästige Pflicht sehen, sondern als Ausdruck einer stärkeren Rechenschaftspflicht von Plattformen und Dienstanbietern. Die Transparenzvorgaben sorgen dafür, dass Informationen nicht versteckt in langen Datenschutzerklärungen stehen, sondern direkt bei der Nutzung eines Dienstes angezeigt werden. Das ist ein Fortschritt für die digitale Selbstbestimmung, auch wenn er im Alltag zunächst unbequem wirken kann. Die eigentliche Aufgabe für die kommenden Jahre wird sein, diese Hinweise so zu gestalten, dass sie für den Nutzer verständlich bleiben und den Informationswert erhöhen, statt nur als weitere Klickhürde empfunden zu werden.
Immer wissen, was in Taucha wichtig ist? Abonnieren Sie unseren WhatsApp-Kanal oder unseren Telegram-Kanal.